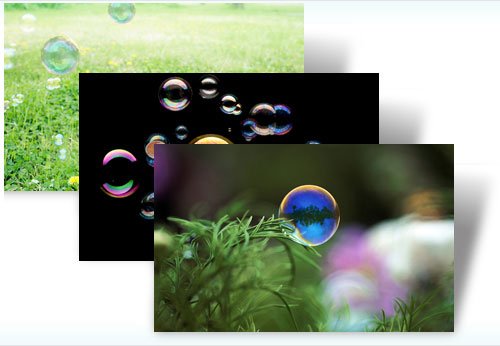31.03.2012 | Tipps
Ob Sie ein eigenes Forum oder eine Website aufsetzen wollen: Im Web gibt es unzählige Web-Anwendungen, die Sie auf Ihren Speicherplatz im Netz hochladen und installieren können. Viele dieser Apps benötigen PHP als Voraussetzung. Dabei ist es nicht egal, welche Version der Webserver nutzt – denn viele Funktionen laufen nur auf aktuellen PHP-Versionen.
Finden Sie daher heraus, welche Version von PHP auf Ihrem Webserver ausgeführt wird. Ungenaue Angaben wie „PHP 5“, die Sie oft auf den Datenblättern der Provider finden, helfen Ihnen dabei nicht weiter: Es gibt zum Beispiel PHP 5.1, 5.2, 5.3 und auch schon 5.4 – und jede unterscheidet sich in den unterstützten Features von den anderen. Es hilft aber, mit dem Windows-Editor (bitte nicht Word verwenden) per Klick auf „Start, Alle Programme, Zubehör, Editor“ zu starten und damit eine Datei mit folgendem Inhalt anzulegen:
<?php phpinfo(); ?>
Speichern Sie die Datei dann als phpdaten.php (die Endung ist wichtig), und laden Sie sie anschließend auf Ihren Webspace hoch. Rufen Sie das Skript dann im Browser mit einer Adresse ähnlich der folgenden auf: www.ihreseite.de/phpdaten.php.
Neben der genauen Versionsnummer finden Sie in den angezeigten Tabellen auch Informationen darüber, welche PHP-Erweiterungen (Extensions) aktiv sind. Das ist nützlich zu wissen, denn einige Fertig-Web-Apps brauchen diese Zusatzfunktionen, um zu funktionieren.


30.03.2012 | Office
Mit dem Musik-Abspieldienst Spotify können Sie – seit März 2012 auch in Deutschland – Ihre Lieblingsmusik anhören, egal ob unterwegs oder zuhause. Besonders praktisch: Sie können eigene Wiedergabelisten anlegen und diese je nach Lust und Laune abspielen. Sie hätten gern eine Datensicherung Ihrer Playlisten? Die Lösung ist einfach: Verwenden Sie ein Word-Dokument.
Starten Sie zunächst Spotify. Klicken Sie dann in der linken Spalte auf die Playlist, von der Sie ein Backup anlegen wollen. Jetzt gleichzeitig die Tasten [Strg]+[A] drücken, um alle Songs der Liste zu markieren (Sie können auch ein Musikstück der Liste markieren und dann auf „Bearbeiten, Alle auswählen“ klicken). Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf einen der markierten Songs, dann auf „Spotify-URL kopieren“ – damit landen die Songs als Links in der Zwischenablage. Nun starten Sie Word und klicken im Menüband (ab Version 2007) auf „Start, Einfügen…“. Zum Schluss das Dokument per Klick auf das Disketten-Symbol abspeichern.
Möchten Sie später ein bestimmtes Lied anhören, klicken Sie in Ihrem Word-Dokument bei gedrückt gehaltener [Strg]-Taste auf den entsprechenden Link. Die Spotify-Website erscheint, gegebenenfalls fragt der Browser nach Erlaubnis. Daraufhin startet sofort Spotify, und die Wiedergabe beginnt.

23.03.2012 | Tipps
Es ist ruhig geworden um Google Streetview. Mit dem Onlinedienst lassen sich bekanntlich 3D-Panoramaansichten von Städten auf den Rechner holen und virtuelle Rundtouren unternehmen. Nur von Städten? Nein, denn jetzt hat Google eine Gegend mit Streetview erkundet, in dem garantiert niemand eine Verpixelung beantragt: Seit dieser Woche ist auch das Amazonas-Gebiet in Streetview abgebildet.
Google hat dazu Boote mit Streetview-Kamera über den Amazonas geschickt und spezielle Dreiräder mit Panoramakameras auf die vielen kleinen Wege geschickt, um alles zu erkunden. Das Ergebnis ist beeindruckend: Mit Streetview eine virtuelle Bootstour auf dem Amazonas machen – das geht jetzt.
View Larger Map

18.03.2012 | Tipps
Ob Word-Text, Foto von der Digitalkamera oder heruntergeladenes Programm-Archiv: Gewöhnlich ist jedem Dateityp eine eigene Endung zugeordnet. Daran erkennt Windows, um welche Art von Datei es sich handelt. Standardmäßig sind diese meist dreibuchstabigen Endungen – zum Beispiel .exe, .jpg – jedoch ausgeblendet.
Böse Zeitgenossen machen sich das zuweilen zunutze und verkaufen in E-Mails oder als Downloads Schad-Programme als harmlose Bilder. Das könnte zum Beispiel so aussehen: „Beispiel.jpg“. Auf den ersten Blick könnte man da versucht sein, eine solche Datei aufzurufen, handelt es sich doch scheinbar nur um eine Grafik. In Wirklichkeit jedoch heißt die Datei „Beispiel.jpg.exe“ – es handelt sich also um eine ausführbare Anwendung, die, einmal gestartet, vermutlich bösartiges Unwesen auf Ihrem PC treibt.
Am sichersten ist es daher, Datei-Erweiterungen immer einzublenden. So erkennen Sie derartige Namens-Fälschungen auf den ersten Blick. Um die Endungen einzublenden, gehen Sie wie folgt vor:
Windows XP
Auf „Start, Arbeitsplatz“ klicken, um den Windows Explorer zu starten. Jetzt in der Menüleiste auf „Extras, Ordneroptionen“ klicken, anschließend zum Tab „Ansicht“ schalten. Unten in der Einstellungsliste den Haken bei „Erweiterungen für bekannte Dateitypen ausblenden“ entfernen. Änderung mit Klick auf „OK“ speichern, sie wird sofort wirksam.
Windows Vista und 7
Klicken Sie auf „Start, Computer“. Anschließend in der Symbolleiste des Windows-Explorers auf „Organisieren, Ordner- und Suchoptionen“ klicken. Jetzt zum Tab „Ansicht“ schalten. Unten in der Einstellungsliste den Haken bei „Erweiterungen für bekannte Dateitypen ausblenden“ entfernen. Klicken Sie schließlich auf „OK“, damit die Datei-Endungen sichtbar werden.
Windows 8
Rufen Sie vom Startbildschirm per Klick den Windows-Explorer auf. Nachdem der Desktop eingeblendet wurde und sich das Explorer-Fenster geöffnet hat, schalten Sie oben im Menüband zum Tab „Ansicht“. Schließlich den Haken setzen bei „Dateinamenerweiterungen“.

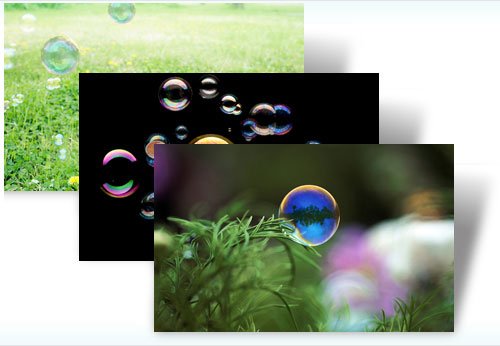
18.03.2012 | Tipps
Was tun, wenn einem das Standard-Aussehen von Windows zu langweilig geworden ist? Bei Windows XP war das blaue Luna-Design Standard, für Vista und Windows 7 hat Microsoft die transparente Aero-Optik voreingestellt. Das Aussehen von Windows lässt sich nach eigenem Geschmack verändern. Wer es nicht bei einem geänderten Hintergrundbild belassen will, sondern auch das Aussehen von Fenstern und Schaltflächen verschönern will, für den gibt es verschiedene Design-Pakete, Skins genannt.
Microsoft selbst bietet für Windows 7 viele unterschiedliche Design-Pakete zum kostenlosen Herunterladen an. Diese werden zu diversen Themen geschnürt und stehen auf der Windows-Website unter windows.microsoft.com/de-DE/windows/downloads/personalize/themes bereit. Die Designs lassen sich in Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise oder Ultimate installieren.

Wer seinem System eine Rundum-Neugestaltung verpassen will, die auch Systemsymbole und Mauszeiger nicht außen vor lässt, dem sei ein Blick auf die Skin-Packs von skinpacks.com empfohlen. Hier wird auch fündig, wer sein Windows-System das Aussehen von Vista, Linux oder Mac OS geben möchte. Sehenswert auf jeden Fall.

13.03.2012 | Tipps
Endlich gibt es Spotify auch bei uns in Deutschland. Die Gema macht es solchen Onlinediensten nicht leicht, in Deutschland Fuß zu fassen. Dabei ist Deutschland der drittgrößte Musikmarkt und für alle sehr interessant. Da kann man mal sehen, wie hemmend Überregulierung sein kann.
Aber das ist nicht die Zeit zum Meckern. Spotify ist also jetzt auch hierzulande nutzbar. Wer sich registriert (geht derzeit leider nur mit einer gültigen Facebook-Mitgliedschaft), bekommt Zugang zu Spotify. Die ersten 48 Stunden kann man den Premium-Service kostenlos nutzen, also uneingeschränktes Spotify – auch ohne hörbare Werbung in der Musik. Kurz danach kommt eine Einladung per Mail: Die Testphase des Premium-Modells lässt sich um 30 Tage erweitern, kostenlos, wenn man bereit ist, Zahlungsdaten zu hinterlegen. Kündigen kann man in den 30 Tagen trotzdem.
Das Premium-Modell ist schon schicker: Man kann Musik auch auf dem Smartphone hören, Playlisten offline anlegen und nutzen, bekommt keine Werbung präsentiert – ganz ehrlich: Ich glaube, dafür bin ich auch bereut 9,99 EUR im Monat zu bezahlen. Aber wir werden sehen, ich habe ja 30 tage zum Ausprobieren. 🙂
Was für eine Auswahl: 16 Millionen Songs stehen bei Spotify zur Verfügung. Aber das haben andere Streaming-Dienste wie Simfy, Deezer oder Rdio auch zu bieten. Spotify ist deswegen erfolgreicher, weil Spotify einfallsreicher ist als die anderen, für jeden Geschmack und Bedarf passende Funktionen anbietet. Man kann zum Beispiel sehen, welche Musik Freunde gerade hören. In der kostenpflichtigen Version von Spotify kann man Musik auch offline anhören, selbst im Smartphone. Man kann sich zu Gruppen zusammen schließend und jemanden zum DJ erklären, der auf virtuellen Partys live Musik abspielt – und vieles andere mehr.
Strategisch klug finde ich die API-Schnittstelle von Spotify: Wer programmieren kann, der kann sich elegant mit Spotify vernetzen, die Inhalte des Streaming-Dienstes nutzen und mit eigenen Angeboten verzahnen. Auf diese Weise sind schon viele Spotify-Apps entstanden, die den Funktionsumfang von Spotify spürbar erweitern – und das erhöht die Akzeptanz eines Onlinedientes wie Spotify (mit demselben Trick ist Twitter groß geworden).
Spotify hat mittlerweile weltweit über zehn Millionen User, rund drei Millionen zahlen für den Dienst – was ich sehr viel finde. Ein Drittel zahlt! Bei kostenlosen Onlinespielen (Free2Play) zahlen gewöhnlich nur fünf bis zehn Prozent. Musik ist anscheinend doch eine Ware, die sich gut verkaufen lässt – wenn man es richtig macht. Aber auch die 70%, die nicht für die Musik zahlen, zahlen letztlich doch. Denn sie bekommen Werbung präsentiert, auf der Webseite, während des Musikhörens. In Form von Radiospots. Das muss sein – denn Streaming-Dienste müssen für jeden gespielten Song bezahlen. 0,6 Cent – den Musiklabels ist es egal, woher das Geld kommt.
Die Musikindustrie kann sich über sprudelnde Einnahmen freuen: Laut Spotify wurden seit 2008 bereits über 200 Millionen Euro an die Musikindustrie an Lizenzen bezahlt.
Ich denke, dem Musik-Streaming gehört die Zukunft. Oder besser: Der geschickten Kombination aus Streaming und Download, denn manche Songs oder Alben möchte man einfach für immer haben. Allerdings brauchen jetzt die Mobilfunkanbieter dringend mal einen Weckruf: Die meisten beschränken die Flatrates für mobilen Datenfunk auf 200 oder 500 MByte im Monat, danach wird von UMTS-Tempo auf 64 KBit/Sekunde gedrosselt. Und mit einer solchen Bandbreite kann man unterwegs keine Musik mehr hören.
Immer gibt es irgend einen Spielverderber.
28.02.2012 | Tipps
Das „Anti Counterfeiting Trade Agreement“ (Acta) ist ein in den letzten Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgehandeltes Abkommen auf völkerrechtlicher Ebene zwischen der EU und Ländern wie USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und einigen anderen Staaten. Ziel des Abkommens sind international einheitliche Mindeststandards zur Abwehr von Produktpiraterie und Urheberrechtsverstößen im Internet. Beides sorgt aus Sicht der Industrie für erhebliche Umsatzeinbußen und soll daher wirkungsvoll international bekämpft werden.
Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Die Frage ist nur, wie das geschehen soll – und genau da regt sich in vielen Ländern zunehmend Widerstand, vor allem bei den Regelungen, die das Internet betreffen. Viele Punkte werden nicht nur von der Netzgemeinde kritisch gesehen, sondern auch von vielen Juristen und zunehmend sogar in der Politik. Kern der Kritik sind die mitunter möglichen Folgen, mit denen bei einer Ratifizierung des Abkommens aus Sicht der Kritiker zu rechnen wäre.
Vor allem befürchten viele erhebliche Einschnitte bei den Rechten im Internet und deutlich mehr Kontrolle. Noch gilt das Internet als Hort der freien Rede und der freien Meinungsäußerung. Jeder soll sagen, schreiben, twittern, posten oder in Videos mitteilen können, was er denkt, fühlt oder meint. Nur ist das längst nicht überall so: China, Iran, Malaysia – in diesen und vielen anderen Ländern ist das Internet nur eingeschränkt verfügbar. Dort sind mitunter komplette Portale gesperrt oder nur bedingt nutzbar, weil entsprechende Gesetze strikte Regeln und Einschränkungen vorsehen. Solche Zustände fürchten nun viele auch für die westliche Welt, wenn auch aus anderen Gründen.
Acta will nicht zensieren, sondern geistiges Eigentum wie Texte, Fotos, Videos, Filme oder Musik im Internet schützen. Die Rechte-Lobby hat im Hintergrund die Strippen gezogen. Es gibt viele Pflichten für Internetbenutzer, aber keine ausdrücklichen Rechte. Weitere Sorge vieler: Legt man das Abkommen wortwörtlich aus, wären beängstigende Szenarien denkbar. Würden alle Staaten Acta unterschreiben, wären Internet-Provider womöglich gezwungen, ihre User zu überwachen.
Was machen die User online? Was laden sie herunter? Verstoßen sie gegen geltendes Recht? Die Provider müssten möglicherweise alles überwachen und dokumentieren. Wird jemand drei Mal ertappt, weil er gegen geltendes Recht verstößt, droht der komplette Ausschluss aus dem Internet. „Three Strike“-Prinzip, nennt sich das. Zwei Ermahnungen, danach ist Schluss.
Abgesehen davon, dass viele andere Ansichten darüber haben, ob und wie geistiges Eigentum im Internet geschützt werden sollte: Die geplanten Methoden, Provider zu dauerhaften Kontrollen zu verpflichten, ist mehr als bedenklich. Zwar meinen Befürworter von Acta, eine derartige Kontrolle wäre durch das Abkommen nicht geplant, doch allein die Tatsache, dass die geplanten Regeln so verstanden werden können, reicht für eine begründete Kritik.
Daher gibt es erheblichen Widerstand gegen das Handelsabkommen, das US-Präsident Barack Obama allerdings bereits unterschrieben hat. Die Community protestiert nachdrücklich gegen die geplanten Gesetze. Es soll noch aufgehalten werden. Deshalb gibt es bereits eine Online-Petition, die bereits über 2,4 Millionen EU-Bürger virtuell unterzeichnet haben.
Doch der Protest beschränkt sich nicht aufs Web: Es gibt auch Demonstrationen auf der Straße. Besorgte Bürger haben in vielen deutschen Städten öffentlich demonstriert. Auch in Polen und einigen anderen Ländern sind bereits Tausende von Menschen auf die Straße gegangen. Ein Widerstand, der durchaus Wirkung zeigt: Die deutsche Regierung hat die Ratifizierung des Abkommens derzeit abgelehnt, selbst Verbraucherministerin Aigner kritisiert die EU-Kommission wegen der Acta-Verhandlungen deutlich.
Das Netz hat sich mal wieder als demokratisches Instrument bewährt: Ohne das Internet wären die Inhalte des Abkommens niemals so schnell bekannt geworden. Die Bürger haben sich im Web informiert, haben in sozialen Netzwerken den Protest organisiert und online Petitionen eingerichtet, alles innerhalb kürzester Zeit. Vergleichbar schnell wäre das in der Offline-Welt niemals möglich gewesen, da wäre das Abkommen längst unterzeichnet gewesen. Die Auswirkungen auf die Politik sind erkennbar und nachhaltig. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass es Acta durch die Instanzen schafft – zumindest nicht in der aktuellen Fassung.
24.02.2012 | Tipps
Smartphones werden immer beliebter: Jedes dritte verkaufte Handy ist mittlerweile bereits ein „schlaues“ Handy, ein Smartphone. Hier können Apps geladen werden, für jeden Zweck. Auf der einen Seite eine gute Sache, so kannman sich ein individuelles Handy zusammenstellen. Auf der anderen Seite aber auch nicht ganz gefahrlos, denn was die Apps so machen – im Zweifel weiß man das nicht.
In den vergangenen Wochen ist bekannt geworden, dass mehrere Dutzend Apps ungefragt Adressen aus dem Smartphone auslesen zum Server der Entwickler schicken. Jetzt soll dem ungenierten Datenmissbrauch ein Riegel vorgeschoben werden. Diesmal hat sich kein deutscher Datenschützer um das Thema gekümmert, sondern eine amerikanische Staatsanwältin.
Datenschutz – für viele amerikanische Unternehmen bislang eher ein Fremdwort. Aber das soll sich jetzt ändern: Eine US-Staatsanwältin hat sechs große US-Firmen, darunter Apple, Google und Microsoft dazu gebracht, eine Vereinbarung zu unterschreiben, die künftig deutlich mehr Datenschutz bedeutet. Zumindest, wenn wir Apps benutzen.
Die Unternehmen verpflichten sich, die im Smartphone gespeicherten Daten besser zu schützen. Ungefragtes Auslesen und Kopieren von Adressen beispielsweise wird dann nicht mehr erlaubt sein. Die Konzerne verpflichten sich, jede App, die sie im App-Store anbieten, auf Einhalten der Datenschutzstandards zu überprüfen. Der Benutzer muss nicht nur aufgeklärt werden, welche Daten vonihm gesammelt werden, sondern auch, was mit den Daten passiert.
Da kommt einiges an Arbeit auf alle App-Entwickler zu. Aber es gibt wirklich kein Grund zum Mitleid: Dieser Schritt in Richtung mehr Datenschutz war dringend nötig. Überfällig. Und ist wirklich zu begrüßen.

23.02.2012 | Software
Bei vielen Gelegenheiten braucht man Grußkarten. Manchmal ist es allerdings schwer, eine passende Karte zu finden. Schön soll sie ja sein, und zum Empfänger passen soll sie auch. Drucken Sie sich doch einfach Ihre eigene Geschenkkarte aus! Erstellen wir gemeinsam eine Karte mit einem Blumenmotiv, das außen auch die Form einer Blume hat. Am Ende soll das Ganze etwa so aussehen:

Wenn Sie eine Maske ins Gesicht ziehen, sehen andere nur noch das, was durch die Löcher schaut. Dieses Prinzip greift auch, wenn Sie bestimmte Bereiche eines Bildes verstecken oder etwas anderes hindurchscheinen lassen wollen. Mit GIMP lassen sich Ebenen-Masken leicht anlegen.
- Öffnen Sie als erstes das Blumenmotiv, das in der Mitte der Karte sichtbar sein soll. Wie wäre es zum Beispiel mit einem selbst fotografierten Blumenstrauß?
- Jetzt eine weiße Ebene anlegen. Klicken Sie dazu im Panel „Ebenen“ unten auf das leere Blatt. Tragen Sie als Name „Weiß“ ein, und wählen Sie als Ebenenfüllart ebenfalls „Weiß“ aus. Schieben Sie die neue Ebene jetzt mit der Maus unter die Ebene „Hintergrund“.
- Als nächstes stellen wir ein, dass das Foto teilweise unsichtbar werden kann. Dazu benötigt die „Hintergrund“-Ebene einen Alphakanal. Fügen Sie diesen per Rechtsklick auf die Ebene hinzu.
- Jetzt auf das Werkzeug „Elliptische Auswahl“ klicken und im Bild einen großen Kreis aufziehen. Danach die [Umschalt]-Taste gedrückt halten, um einen kleineren Kreis am Rande des großen Kreises zur Auswahl hinzuzufügen. Den letzten Schritt öfter wiederholen, bis der gesamte Rand des großen Kreises mit kleinen Kreisen besetzt ist.
- Schließlich das Foto maskieren. Dazu mit der rechten Maustaste auf die Ebene „Hintergrund“ klicken und eine „Ebenenmaske hinzufügen“. Die Einstellung bei „Ebenenmaske initialisieren mit“ auf „Auswahl“ stellen, danach auf „OK“ klicken.
Zum Schluss das Bild unter einem anderen Namen speichern, indem Sie auf „Datei, Speichern unter…“ klicken. Tippen Sie als Dateiendung „.jpg“ ein. Das fertige Bild lässt sich dann, beispielsweise in Microsoft Word, einfügen und ausdrucken.
[wpfilebase tag=’attachments‘]
15.02.2012 | Tipps
Für Schulaufgaben und wissenschaftliche Berechnungen ist es praktisch, wenn man Formeln und Graphen direkt am PC einsehen und auswerten kann. Dafür hat Microsoft ein kostenloses Tool bereitgestellt: Mathematics.
Im Programm-Paket enthalten ist ein Rechner, der 2D- und 3D-Diagramme zeichnen kann, Gleichungen Schritt für Schritt löst und Mathe- und Naturwissenschaften-Schülern weiterhilft. Komplizierte Formeln lassen sich auch ohne Umweg direkt über die eingebaute Handschrift-Erkennung eintippen. Abgerundet wird Mathematics durch eine direkte Anbindung zu Microsofts Word-Editor.
Das Mathematik-Paket wurde früher Microsoft Math genannt. Es lässt sich von folgender Adresse herunterladen:
https://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?familyid=9caca722-5235-401c-8d3f-9e242b794c3a