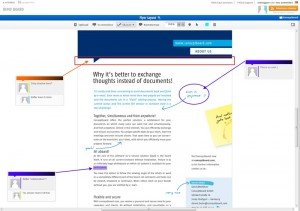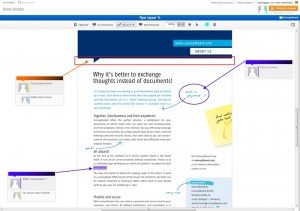15.11.2011 | Tipps
Bei Windows gibt’s jede Menge versteckte Dateien. Damit soll verhindert werden, dass wichtige Datien versehentlich gelöscht werden. Wer häufiger mit den versteckten Dateien arbeiten muss, kann sie im Eigenschaftsfenster des Explorers sichtbar machen. Allerdings dauert es etliche Klicks, bis die Einstellungen geändert und nach dem Bearbeiten erneut angepasst wurden. Mit zwei selbstgemachten Verknüpfungen geht’s schneller.
Wer versteckte Dateien per Doppelklick sichtbar und genau so einfach wieder unsichtbar machen möchte, geht folgendermaßen vor: Den Windows-Editor starten und folgenden Text eintippen (oder besser: über die Zwischenablage kopieren und einfügen):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
„Hidden“=dword:00000001
Diese Datei unter dem Namen „verstecken.reg“ auf dem Desktop speichern. Danach auf gleiche Weise eine weitere Textdatei mit folgendem Inhalt erstellen und als „anzeigen.reg“ speichern:
Windows Registry Editor Version 5.00
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
„Hidden“=dword:00000002
Um die Einstellungen zu ändern, muss nur doppelt auf die jeweilige .reg-Datei geklickt und die Warnmeldung bestätigt werden. Sichtbar werden die Änderungen im Explorer aber erst, wenn mit [F5] die Anzeige aktualisiert wird.
15.11.2011 | Tipps
Sobald im Internet Explorer eine neue Registerkarte geöffnet wird – zum Beispiel mit der Tastenkombination [Strg][T] -, erscheint eine zweizeilige Übersicht der beliebtesten und am häufigsten besuchten Webseiten. Wer mehr als die maximal zehn Vorschläge sehen möchte, kann die Vorschlagsliste um weitere Einträge erweitern.
Dazu ist eine kleine Änderungen im Registrierungseditor notwendig. So geht’s: Mit der Tastenkombination [Windows-Taste][R] und der Eingabe des Befehls „regedit“ den Registry-Editor starten. Dort den folgenden Ordner öffnen und markieren:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing\NewTabPage
Anschließend den Befehl „Bearbeiten | Neu | DWORD-Wert (32-Bit)“ aufrufen und dem neu hinzugefügten Eintrag den Namen „NumRows“ geben. Danach doppelt auf den neuen Eintrag „NumRows“ klicken und die gewünschte Anzahl eingeben – etwa „4“ für vier Zeilen mit je fünf Vorschlägen.
08.11.2011 | Tipps
In Deutschland ist der Nachrichtendienst Twitter bei weitem nicht so bekannt und beliebt wie in den USA. Dennoch: Twitter hat auch bei uns zahlreiche Fans – und es werden immer mehr. Länger als 140 Zeichen darf eine Twitter-Nachricht bekanntlich nicht sein, weniger Text als in einer SMS. Trotzdem kann ein Tweet einiges bewegen. Gerne werden Beispiele wie die erfolgreiche Kommunikation in Iran, Ägypten oder Lybien genannt. In solchen Gebieten hilft Twitter immer wieder, dass sich die Menschen mobil austauschen und organisieren.
Das ist gut und wichtig, aber Twitter spielt auch im weniger turbulenten Leben schon mal eine Rolle. Das wollen die „Twitter Stories“ unter stories.twitter.com erzählen. Hier gibt es Beispiele, wie mitunter eine einzige Twitter-Nachricht ein ganzes Leben verändert hat. Die Geschichten werden teilweise auch in gut gemachten, kurzen Einspielfilmen erzählt.
Beispiel: Ein Film erzählt von einer kleinen Buchhandlung namens „Broadway Books“ in Portland, Oregon, in den USA. Klein, fein, von einer älteren Dame betrieben. Doch wie das mit kleinen, feinen Buchläden so ist: Sie laufen nicht mehr so gut. Die großen Ketten walzen alles nieder, und dann kommt auch noch die allgegenwärtige Wirtschaftskrise. Doch der Sohn hat eine Idee: Er schreibt einen Blogeintrag, der die Leute auffordert, den Buchladen zu retten und dort Bücher zu kaufen.
Das Ganze hat er dann noch getwittert. Das hat dann eine Lawine in Gang gesetzt, der Buchladen war gerettet, weil Menschen aus dem ganzen Land gekommen sind und bei Broadway Books Bücher gekauft haben. Buchladen gerettet – bis heute.
Zugegeben: Eine recht kitschige Geschichte, die man glatt mit Tom Hanks und Meg Ryan verfilmen könnte, aber trotzdem: Die Geschichte ist wahr, und sie ist ein Beispiel, wie Twitter tatsächlich einiges bewegen kann.
Solche Reaktionen sind durchaus realistisch, allerdings nicht planbar. Denn die Menschen, die Twitter benutzen, entscheiden, was spannend und interessant genug ist, um im Schneeballeffekt bekannt zu werden. Wenn einem etwas gefällt, was man gelesen hat, dann re-twittert man das, man schickt es erneut raus, an seine eigenen Twitter-Leser. Wenn das genügend Leute machen, kann es einen Schneeballeffekt geben – und dann kann eine Nachricht mühelos hunderttausende von Lesern erreichen, zumindest in den USA. Da haben manche Twitterer, allen voran Ashton Kutcher, weit über acht Millionen Leser.
Twitter Stories erzählt solche Geschichten, einige im Filmen, einige zum Nachlesen. Die Filme sind in englischer Sprache, die Begleittexte aber in Deutsch, man bekommt also auf jeden Fall mit, worum es geht.
Da wird zum Beispiel auch die Geschichte von Chad Ochocinco erzählt, einem bekannten Football-Star aus den USA. Viele bekannte Sportler twittern in den USA. Chad Ochocinco hat sage und schreibe 2,8 Millionen Follower, also 2,8 Millionen Menschen, die regelmäßig lesen, was er so schreibt. Und er hat verrückte Einfälle. Er lädt immer wieder auf seinem Twitter-Kanal zum Abendessen ein: Wer schnell genug ist und in der Stadt, in der Chad Ochocinco sich gerade aufhält, der wird schon mal zum Steak oder Schrimps-Essen eingeladen, einfach so, auf Twitter.
Oder da gibt es Maureen Evans. Sie verschickt regelmäßig komplette Rezepte als Tweet. Das bedeutet: Sie muss sich auf 140 Zeichen beschränken, was mitunter schon recht schwierig ist. Beinahe jeden Tag twittert Maureen Evans ein neues Rezept. Ihre Haiku-Begeisterung und ihr Talent, Rezepte auf deren essentielle Elemente zu reduzieren, erlauben es ihr, Rezepte per Twitter mit anderen zu teilen. Ihre Follower antworten mit eigenen Kreationen und Kommentaren und tragen somit zu einer globalen Konversation über Rezepte der Welt bei. Kürzlich twitterte sie über Biscoitos de Canela, Broccolini alla Romana, Himbeer Cranachan, Croquetes D’Espinacs und Waffeln.
Es gibt viele schöne Beispiele, auch die ersten Tweets aus dem All kann man nachlesen – von Kosmonauten, die halt twittern. Recht unterhaltsam – und es macht neugierig auf diesen Nachrichtendienst, den viele bei uns ja nicht so recht verstehen und deshalb links liegen lassen.
So viele treue Leser zu bekommen, gelingt nicht aus dem Stand. Wer sich bei Twitter anmeldet und loslegt, hat erst mal keinen einzigen Leser, Follower. Aber man folgt anderen, die folgen dann wieder einem selbst, und wenn man spannende Dinge schreibt, die andere interessieren oder bewegen, dann tritt der erwähnte Schneeballeffekt ein und man bekommt mehr Follower.
Was einem klar sein muss: Wer bei Twitter etwas verschickt, der macht das gewöhnlich öffentlich. Jeder kann lesen was man schreibt. Auch Suchmaschinen, sie durchforsten das Gezwitscher auf Twitter und bilden das immer öfter auch in den Suchmaschinen ab. Man kann auch genau sehen, was ein Twitterer in der Vergangenheit geschrieben hat und wann. Deshalb wird Twitter auch als „Microblogging-Dienst“ bezeichnet, weil mit der Zeit eine Chronologie, eine Geschichte, ein Profil entsteht. Es ist also nicht so wie bei der SMS, dass man mit ausgewählten Personen diskret kommuniziert, sondern man kommuniziert schon öffentlich.
Übrigens kann man nicht nur 140 Zeichen lange Nachrichten verschicken, sondern auch Fotos. Die werden dann auf Servern zwischengespeichert und kurze Internetadressen generiert, die auf diese Fotos verweisen – und die kann man sich dann so in Twitternachrichten anschauen.
Twitter entwickelt sich nicht zum Massenphänomen, aber ist doch mittlerweile ein relevantes Medium im Internet geworden, das nicht mehr wegzudenken ist. Und wer es geschickt einzusetzen versteht, der kann eben durchaus etwas bewegen, das zeigen die Twitter-Stories.
24.10.2011 | Tipps
Im „echten Leben“ gehört es zum guten Ton, sich mit seinem Namen vorzustellen. Ganz anders im Internet: Viele verwenden in Blogs, Foren und sozialen Netzwerken lieber Pseudonyme. Manche Politiker fordern, dass sich User im Netz mit Klarnamen zu erkennen geben sollten, auch manche Onlinedienste erwarten das von ihren Usern. Das würde ein Ende der Anonymität im Netz bedeuten und hat im Web eine heftige Diskussion in Gang gebracht. Mittlerweile sagt aber auch Google: Pseudonyme sind wichtig – und will sie demnächst erlauben.
Es gibt viele überzeugende Gründe, im Internet auch in Zukunft nicht auf Pseudonyme zu verzichten. Auf der Webseite my.nameis.me („Mein Name ist ich“) erklären Onlineuser aus aller Welt, warum sie ein Pseudonym verwenden und bevorzugen. Viele berichten hier sehr persönliche Dinge, was sie erlebt haben und wieso sie deshalb ein Pseudonym benutzen.
Es gibt viele gute Gründe, den eigenen Namen online zu vermeiden. So wollen Lehrer nicht von ihren Schülern enttarnt werden, Menschen mit Krankheiten, Behinderungen oder Sorgen wollen sich in Foren austauschen, ohne eindeutig identifiziert werden zu können. Andere sind bereits Opfer von Stalkern geworden oder wollen ganz generell ihren richtigen Namen nicht im Netz verwenden, etwa um sich vor Werbung zu schützen.
Vor allem Frauen bevorzugen es, im Netz ein Pseudonym zu verwenden. Aus gutem Grund: Wie die Universität Maryland bereits 2006 in einer Studie ermittelt hat, sind User mit weiblich klingendem Nutzernamen in Chaträumen 25 Mal häufiger verbalen Drohungen und sexuellen Anmachen ausgesetzt als Personen mit männlichen Namen. Aber auch die (vermeintliche) Herkunft kann eine Rolle spielen. Wer Mohammed heißt und allein schon deswegen in einem Blog oder Forum wiederholt als Islamist beschimpft wird, wird sich irgendwann für ein Pseudonym entscheiden. Sich einfach das Leben einfacher zu machen, wenn man online geht, ist zweifellos auch ein legitimer Grund, ein Pseudonym zu wählen.
Selbst wenn sich ein einzelnes Land wie Deutschland dazu entschließen sollte, in Blogs und sozialen Netzwerken grundsätzlich die Verwendung von Klarnamen vorzuschreiben, wäre es kinderleicht, über den Umweg Ausland auf Klarnamen zu verzichten. Außerdem wäre so eine Vorschrift vergleichsweise schwer umzusetzen. Wie sollen soziale Netzwerke prüfen, ob ein Name ein Klarname oder ein Pseudonym, ausgedacht oder echt ist? Wie ist es mit Künstlernamen? Die Folge wäre ein enormer administrativer Aufwand. Abgesehen davon verstößt das gegen Geist und Wesen des Internet.
Nach den Attentaten in Norwegen ist die Diskussion in Deutschland angekommen: Es hat norwegische Blogger gegeben, die sich hinter einem Pseudonym versteckt haben. International wird das Thema aber schon länger diskutiert. So hat Google im Juli beschlossen, in seinem neuen sozialen Netzwerk Google+ nur Klarnamen zuzulassen. Die AGBs wurden entsprechend angepasst. Wenig später hat Google einige Profile mit angeblich offensichtlichen Pseudonymen gelöscht. Daraufhin hat der Protest begonnen: Darf ein Onlinedienst das, so etwas vorschreiben, nutzt Google nicht seine Macht aus, wenn es bestimmen können will, wer sich mit Pseudonym oder Künstlernamen anmelden darf und wer nicht?
Seit einer Weile ist Google etwas großzügiger, auch Pseudonyme werden zugelassen, sofern sie nicht zu absurd erscheinen. Vorbild ist Facebook: Das Netzwerk hat seine Mitglieder von Anfang an aufgefordert, sich mit echtem Namen anzumelden. Doch konsequent eingehalten wird das auch nicht. Die übliche Begründung: Die Umgangsformen werden besser, die Atmosphäre ist entspannter. Teilweise stimmt das auch.
Google+ hat lange dieselbe Politik verfolgt und argumentiert, Klarnamen dienten der Bekämpfung von Spam und beugen gefälschten Profilen vor. Doch nun schwenkt auch Google um und erlaubt in Google+ künftig Pseudonyme.
21.10.2011 | Tipps
Diese Woche haben bei Sicherheitsexperten in aller Welt die Alarmglocken geläutet: Mit GuQu ist ein Nachfolger des gefährlichen Stuxnet-Wurms aufgetaucht. Stuxnet hat es gezielt auf Industrieanlagen abgesehen und war hochgradig professionell programmiert worden.
Nach dem Medienrummel um Stuxnet war man davon ausgegangen, dass die dafür Verantwortlichen sich zurückziehen, um nicht aufzufallen.
Doch jetzt kommt ein Nachfolger, der eindeutig dieselbe Handschrift trägt, von denselben Leuten gemacht wurde. Und wieder geht es darum, gezielt Informationen über Industrieanlagen auszuspionieren. Anders als Stuxnet verbreitet sich DuQu nicht selbst weiter. DuQu ist ein Beleg dafür, dass immer professioneller spioniert wird. Auch in der Industrie.
18.10.2011 | Tipps
Die aktuelle Diskussion um den Staatstrojaner macht deutlich, wie angreifbar unsere Computer sind. Schnell hat sich ein Trojaner eingenistet, der sensible Daten ausspioniert. Viele wollen deshalb wissen, ob sie bereits Opfer einer Schnüffelattacke geworden sind und wie ein sicheres Passwort aussieht.
Es gibt eine Webseite, auf der jeder nachschauen kann, ob Hacker schon mal erfolgreich das eigene Konto geknackt haben. Da die meisten Onlinedienste dazu die E-Mail-Adresse in Kombination mit einem Passwort abfragen, kann man unter www.shouldichangemypassword.com die eigene E-Mail-Adresse eintragen. Die Webseite verrät danach, ob dieses Konto in Hackerkreisen schon mal Thema war.
Die Betreiber der Seite verfügen über brisantes Datenmaterial, etwa Listen mit E-Mail-Adressen und Passwörtern, die schon mal geknackt wurden. Kann shouldichangemypassword.com in diesen Listen, ist das alarmierend: In diesem Fall sollte man dringend alle Passwörter ändern, denn dann ist man mindestens einmal geknackt worden, ohne es zu merken. Das muss nicht zwingend Folgen gehabt haben – doch es könnte noch passieren.
Should I change my Password?
Die Betreiber von shouldichangemypassword.com haben Zugriff auf in Hackerkreisen kursierende Logins, auf Datenbanken mit Zugangsdaten, die in Hackerkreisen gehandelt werden. Es gibt schließlich immer wieder Hacker, die Logins verkaufen oder damit angeben, wie viele Logins sie geknackt haben. Natürlich bekommen die Betreiber von shouldichangemypassword nicht alles mit, aber sie haben durchaus Zugriff auf eine nennenswerte Zahl von Datenbanken. So gesehen ist die Webseite eine Art Google auf Hacker-Daten, etwas zugespitzt formuliert.
Wenn shouldichangemypassword.com nichts in den Datenbanken findet, bedeutet das allerdings nicht, dass man vollkommen sicher ist und dass noch kein Hacker ein Konto geentert hat.
Shouldichangemypassword bezieht sich allerdings ausschließlich auf Mail-Logins. Wer andere Zugangsdaten benutzt, etwa in der Firma oder bei einem Onlinedienst, der kommt mit diesem Angebot nicht weiter. Aber: Es ist ganz nützlich, es mal auszuprobieren – und, sich Gedanken um ein möglichst sicheres Passwort zu machen.
Sicheres Passwort wählen
Eins muss klar sein: Je einfacher das Passwort, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es geknackt wird. Hacker nutzen heute Hochleistungscomputer, um Passwörter zu knacken. Ein handelsüblicher PC kann heute rund 25 Millionen Passwörter in der Sekunde ausprobieren. Ein simples Passwort ist da innerhalb kürzester Zeit geknackt. Der einzige Schutz, kein Opfer zu werden, ist ein gut gewähltes Passwort.
Ganz wichtig: Keine Eigennamen verwenden wie Paul, Anna, Jörg oder Fritz. Keine simplen Floskeln wie „i love you“. Die Hacker sind nicht dumm: Die kennen die beliebtesten Passwörter und probieren diese als erstes aus, sowieso nicht mit der Hand, sondern es gibt elektronische Wörterbücher, in denen die populärsten Passwörter drin stehen, und die werden als erstes ausprobiert.
Darum muss man ein Passwort benutzen, das möglichst einzigartig ist und nicht in Wörterbücher stehen kann. Ein gutes Passwort ist lang, mindestens 10 Zeichen, je mehr, desto besser. Es enthält Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen. Eine Kombination aus allem. Wenn man schon Wörter benutzt, die im Wörterbuch stehen, dann mit gemischter Schreibweise, also groß und klein. Gerne auch mit Gimmicks, etwa indem man eine „3“ schreibt, wo ein „e“ vorkommt, eine drei sieht aus wie ein umgekehrtes „e“, kann man sich also gut merken, oder mit einem Ausrufezeichen für das „i“, oder was auch immer, das kann sich jeder selbst ausdenken.
Auf diese Weise entsteht ein einmaliges, nahezu unknackbares Passwort, weil kein Knack-Algorithmus darauf so leicht kommen kann. Gut ist auch, sich einen Satz einzuprägen und immer nur die ersten Buchstaben im Passwort zu benutzen, auch wieder mit Groß- und Kleinschreibung, etwa: „Funkhaus Europa ist ein klasse Sender, den ich jeden Tag höre.“ Also: „FEiekSdijTh“. Unknackbar, erst recht, wenn ich jetzt noch Sonderzeichen benutze und Ziffern.
Es gibt Onlinedienste, auf denen man überprüfen kann, wie gut oder schlecht ein Passwort ist. Microsoft hat so einen Dienst im Angebot, aber auch der Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich, hier wird einem sogar gesagt, warum ein Passwort möglicherweise schwach ist, sehr aufschlussreich.
Wichtig – wenn auch in der Praxis schwer umzusetzen: Für jeden Onlinedienst ein eigenes Passwort verwenden. Denn sonst gilt: Hat ein Hacker einen Zugang geknackt, kann er überall rein.
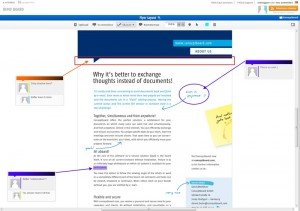
12.10.2011 | Tipps
Ob in der Schule, während des Studiums, am Arbeitsplatz oder im Verein: Überall gehört Teamarbeit dazu. Doch alle Mitglieder eines Teams, alle Kollegen, Kommilitonen oder Freunde gleichzeitig an einen Tisch zu bekommen, ist erfahrungsgemäß schwierig. Ständig E-Mails hin und her zu senden ist überaus unpraktisch, gerade wenn man gemeinsam an einem Dokument arbeiten möchte.
Das Internet bietet für dieses Problem bessere Lösungen. Eine davon ist Conceptboard, ein Service für die effiziente Teamarbeit im Web. Im Mittelpunkt steht ein Whiteboard, das quasi als virtueller Konferenzraum dient. Hier treffen sich die Mitglieder einer Projektgruppe, um online an Dokumenten, Bildern oder Tabellen zu arbeiten. Hier lassen sich auch Notizen oder Zeichnungen anlegen und gemeinsam bearbeiten.
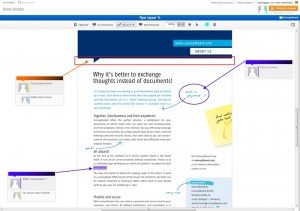 Sobald ein Anwender eine Änderung vornimmt, sehen die anderen Benutzer das. Praktisch: Es müssen nicht alle gleichzeitig eingeloggt sein, auch zeitversetzt lässt sich gemeinsam arbeiten. Dazu laden Benutzer etwa eine Word-Datei hoch, die mit den entsprechenden Werkezeugen bearbeitet wird als wäre es ein Ausdruck: Markierungen, Grafiken und Kommentare werden eingefügt. Letztere können in Aufgaben umgewandelt werden, so dass anderer darauf reagieren müssen.
Sobald ein Anwender eine Änderung vornimmt, sehen die anderen Benutzer das. Praktisch: Es müssen nicht alle gleichzeitig eingeloggt sein, auch zeitversetzt lässt sich gemeinsam arbeiten. Dazu laden Benutzer etwa eine Word-Datei hoch, die mit den entsprechenden Werkezeugen bearbeitet wird als wäre es ein Ausdruck: Markierungen, Grafiken und Kommentare werden eingefügt. Letztere können in Aufgaben umgewandelt werden, so dass anderer darauf reagieren müssen.
Benutzer ohne Konto bei Conceptboard können ebenfalls mitmachen, nur eine Einladung per E-Mail ist dafür nötig. So lassen sich spontan Sitzungen mit beliebigen Anwendern realisieren. Bei Bedarf legen Nutzer mehrere Boards an, um mit unterschiedlichen Benutzern an verschiedenen Projekten zu arbeiten. An diese lassen sich zudem beliebige Dateien anhängen, die die Teammitglieder herunterladen können. Das spart den Versand von E-Mails.
Für den privaten Einsatz ist Conceptboard kostenlos. Bis zu 25 Boards und beliebig viele Gäste sind damit möglich. Gewerbliche Nutzer müssen etwas zahlen, erhalten dafür aber auch mehr Funktionen, etwa ein Mitarbeiter-Management und die Möglichkeit, das Firmenlogo auf dem Whiteboard zu platzieren.
www.conceptboard.com
10.10.2011 | Tipps
Bei Google Chrome gibt’s kein Google-Suchfeld. Wozu auch? Wer etwas sucht, gibt es direkt ins Adressfeld ein. Das funktioniert auch beim Firefox. Allerdings erst, wenn die Suche im Adressfeld aktiviert wird.
Und zwar folgendermaßen: Ins Firefox-Adressfeld den Befehl „about:config“ eingeben und mit [Return] bestätigen. Die Warnung per Klick auf „Ich werde vorsichtig sein, versprochen“ bestätigen. In der folgenden Liste doppelt auf den Eintrag „keyword.url“ klicken und als Wert folgendes eintragen:
https://www.google.de/search?q=
Jetzt lassen sich Google-Suchen direkt übers Adressfeld starten.
07.10.2011 | Tipps
Es war im Orwell-Jahr 1984, als Steve Jobs dem Erzrivalen IBM offiziell den Krieg erklärt hat. Mit einem unter die Haut gehenden Fernsehspot, ausgestrahlt während des Superbowl, die teuerste Werbezeit im amerikanischen Fernsehen. Der bedrückend wirkende Werbeclip spielt mit den Ängsten der Menschen. Die Message: Seid keine Herdentiere. Kauft keine Computer beim Marktführer – kauft lieber einen Apple Macintosh.
Mit Emotionen spielen, um die Ecke denken, etwas wagen, was andere sich nicht trauen: Das war für Steve Jobs immer selbstverständlich. Das hat ihn ausgemacht, das hat ihm den Ruf des Underdog eingebracht. Mit dieser Strategie hat er Apple über die Jahre zu einer Marke gemacht. Mehr als das: Apple ist zum wertvollsten Unternehmen der Welt geworden. Vom Underdog zum Keyplayer. Trotzdem finden die meisten Apple immer noch sympathisch. Das muss man erst mal schaffen.
httpv://www.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8
Steve Jobs hat so viele Geräte erfunden, teilweise auch neu erfunden: Computer, MP3-Player, Smartphone, Tablet-PC. Wenn Apple sich damit beschäftigt hat, gab es immer etwas zum Staunen. Jobs hat die Geräte grundsätzlich selbst präsentiert. Mit Charisma. Ein perfekter Verkäufer, denn immer hatte man das Gefühl: Der Mann steht wirklich dahinter. Uneingeschränkt.
Geräte von Apple sind immer das entscheidende bisschen anders, sehen meist klasse aus, funktionieren tadellos und wecken Begehrlichkeit. Steve Jobs musste in den letzten Jahren nur wenige Flops verkraften.
Jobs hat Apple vom Computerhersteller zum Medienunternehmen umgeformt und so ganz nebenbei den Lifestyle einer ganzen Generation geprägt. Handys mit den Fingern bedienen, unterwegs online gehen und online Musik laden oder Filme downloaden – ohne Apple wäre das wohl nie so populär geworden.
Gleichzeitig hat Jobs es geschafft, Kunden, die ein Stück Hardware kaufen, zu dauerhaften Kunden zu machen, indem er ihnen die Software, die Medien, exklusiv auf seinen Plattformen verkauft. Musik, Videos, Filme, eBooks, Apps – können sich Benutzer von Apple-Geräten ausschließlich bei Apple besorgen. Die Kunden kaufen zwar Hardware, können damit aber nicht machen, was sie wollen. Apple diktiert, was geht und was nicht.
Erstaunlicherweise nimmt das dem Unternehmen kaum einer übel. Milliarden Downloads spülen seitdem Milliarden von Extra-Dollar in die Kassen des Apfel-Unternehmens. Geld verdienen mit fremden Inhalten, das ist schon eine Leistung.
Keine Frage: Steve Jobs war kein Manager von der Stange – er war ein Unikat. Visionär. Mutig. Durchsetzungsstark. Charismatisch. Er hat immer gesagt, was er dachte. Er wusste immer ganz genau, was er wollte – und was nicht. Und ganz sicher wollte er keine Kompromisse. Seine Mitarbeiter haben darunter mitunter gelitten. Aber der Firma hat das gut getan. Ungewöhnliche Produkte entstehen nicht durch Mittelmäßigkeit oder zu viel Freude an Kompromissen. Ganz sicher nicht.
httpv://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
Wenn Steve Jobs einen Fehler gemacht hat, dann sich nicht rechtzeitig um einen angemessenen Nachfolger zu kümmern, seine Firma nicht darauf vorbereitet zu haben, dass er vielleicht irgendwann nicht mehr auf der Brücke steht. Jetzt ist es so weit – und Apple wird darunter ohne jeden Zweifel leiden. Apple wird mehr oder weniger eine normale Firma werden. Weniger innovativ, weniger schlagkräftig, weniger druckvoll. Weniger Steve Jobs. Schade.
06.10.2011 | Tipps
Es gibt wohl kaum jemanden auf der Welt, der noch nichts von Steve Jobs gehört hat. Aus gutem Grund, schließlich hat der Mann nicht nur seiner Firma Apple zu einem wirtschaftlichen Höhenflug ohne Vergleich verholfen – Apple gilt mittlerweile offiziell als wertvollstes Unternehmen der Welt –, sondern er hat auch die Medienlandschaft der letzten Jahre geprägt wie kein zweiter. Jobs hat radikal die Art und Weise verändert, wie wir Musik hören, wie wir Filme anschauen und unterwegs online gehen. Er hat den Lifestyle einer ganzen Generation geprägt.
Steve Jobs hat den amerikanischen Traum gelebt. 1955 als Kind eines syrischen Einwanderers geboren, als Adoptivkind groß geworden hat Jobs 1976 die Firma Apple gegründet, in einer der legendären Garagen des Silicon Valleys in Kalifornien. In Palo Alto, wo Jobs jetzt auch verstorben ist.
Steve Jobs war schon immer ein Technik-Fan und hat sich irgendwann zu einem Guru entwickelt. Herausforderungen hat er nie gescheut, von Anfang an nicht. Im Gegenteil: Widerstände waren stets Ansporn. Als Apple 1984 beispielsweise den Apple Macintosh vorstellte, hat sich das damals noch vergleichsweise winzige Unternehmen ohne mit der Wimper zu zucken mit dem Giganten IBM angelegt. „Think different!“, so lautete lange Zeit das Firmenmotto. Denk doch mal um die Ecke. David gegen Goliath – das hat vielen imponiert und lange das Image von Apple geprägt.
Unter Jobs Ägide hat es Apple vom Underground zum Marktführer gebracht, ohne dabei erkennbar an Charme einzubüßen. Auch heute gilt Apple vielen noch als sympathisches Unternehmen, dem man einfach vertraut. Trotz der beeindruckenden Größe, die Apple mittlerweile hat. Trotz des Kontrollwahns, den Apple ungeniert an den Tag legt: Wer ein iPhone, iPod oder iPad kauft, kann kaum selbst bestimmen, was auf dem Gerät läuft oder zu sehen ist. Apple behält die Kontrolle über alles, weiß alles.
Strikte Kontrolle – so hat Jobs auch seine Firma geführt. Alles war auf seine Person zugeschnitten. Jobs galt vielen als strenger, zuweilen sogar hysterischer Chef, der gerne auch schon mal unangenehm werden konnte. Er wollte stets, dass seine Ideen und Vorstellungen umgesetzt werden, kompromisslos, pünktlich, ohne Wenn und Aber – und stets unter strengster Geheimhaltung. Was vielen als unsympathisch erscheint, war in Wahrheit aber ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs: Jobs hat seine Ideen grundsätzlich ohne Abstriche umgesetzt.
Seine Karriere kennt eigentlich nur eine Delle: 1985 musste Jobs das von ihm selbst gegründete Unternehmen infolge eines Machtkampfes mit dem damals angeheuerten Manager John Sculley verlassen. 1996 kehrte er zu Apple zurück und hat die Firma, die damals kurz vor dem Untergang stand, mit klugen Entscheidungen und Produktideen wie dem iMac zur wertvollsten Marke weltweit gemacht.
Mehr als das: Jobs hat aus dem Computerhersteller Apple ein Medienunternehmen gemacht. Er hat den bunten iMac eingeführt, den iPod erfunden, das iPhone erdacht, den iPad aus der Taufe gehoben – und dabei immer darauf geachtet, dass die Geräte nicht nur schick aussehen und einfach zu bedienen sind, sondern ein paar interessante Extras zu bieten haben, die andere Hersteller vermissen lassen. Etwas Emotionales, das die Leute vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber ganz sicher wollen.
Onlinedienste etwa, die einen mit Musik, Filmen, eBooks und Apps versorgen. So etwas ist nicht nur praktisch, sondern gleichzeitig eine nie versiegende Einnahmequelle für das Unternehmen. Dank iPod, iPad und iPhone ist Apple zu einem wichtigen Player im Mediengeschäft geworden, weil Apple nicht nur Geräte verkauft, sondern auch gleich die Inhalte. Apple versorgt Millionen Menschen online mit Inhalten. Nicht zur reinen Freude der traditionellen Medien, die ihren Einfluss schwinden sehen. Denn Apple verdient kräftig mit, egal ob Musik, Filme, Apps oder eBooks verkauft werden.
Das eigentlich Unmachbare vornehmen – das war das Motto von Jobs. Und er hat es häufig tatsächlich geschafft, seine Ideen umzusetzen. Häufig, nicht immer. Von Misserfolgen wie dem Apple Newton spricht heute kaum noch jemand. Dabei war der Newston so eine Art Vorgänger des iPad. Die Zeit war einfach noch nicht reif.
Häufiger aber hat es geklappt. Wer hätte beispielsweise 1984 gedacht, dass man tatsächlich gegen IBM ankommen kann? Wer hätte gedacht, dass ein Computerhersteller Musik verkaufen kann? Apple hat es geschafft und ist mittlerweile zum wichtigsten Onlineanbieter von Musik weltweit geworden. Musiklabels aus aller Welt sind darauf angewiesen, bei iTunes vertreten zu sein.
Wer hätte gedacht, dass ein Computerhersteller ein Handy bauen kann? Die Großen der Branche haben sich anfangs ins Fäustchen gelacht. Doch Jobs hat die Art und Weise, wie Handys genutzt werden, revolutioniert. Mit Touchscreen ausgestattet, schick gestaltet und einfach zu bedienen – das war dann eben doch neu.
Seit 2004 litt Steve Jobs an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Öffentlich darüber gesprochen hat er ungern und selten. Nicht zuletzt, weil Spekulationen über seinen Gesundheitszustand immer auch Apple geschadet haben, zu sehr war das Unternehmen in den letzten Jahren auf die Person Jobs zugeschnitten. 2004 wurde Jobs operiert, 2009 musste er sich einer Lebertransplantation unterziehen. Im Augst 2011 hat sich Jobs dann offiziell aus dem Unternehmen verabschiedet.
Erst seit wenigen Wochen ist Tom Cook Chef des Medienunternehmens Apple. Die Fußstapfen, die Steve Jobs hinterlassen hat, sind gigantisch. Niemand wird sie ernsthaft füllen können. Apple wird ein anderes Unternehmen sein ohne Steve Jobs, ein mehr oder weniger normales Unternehmen, weniger innovativ, weniger charismatisch, weniger mutig.